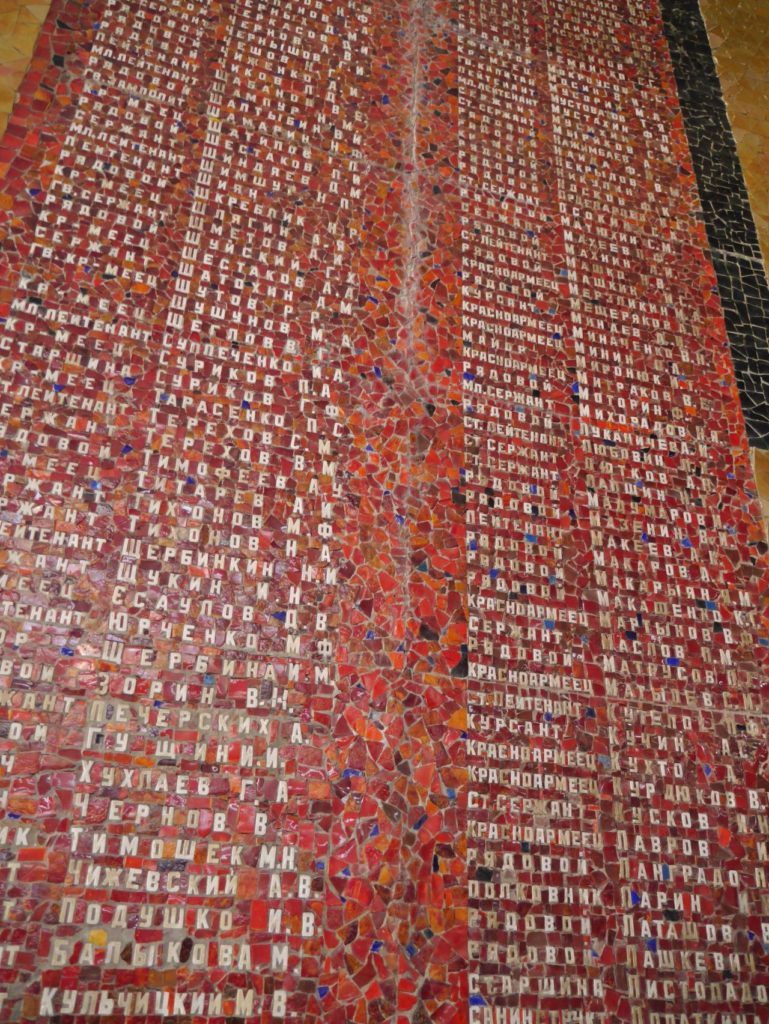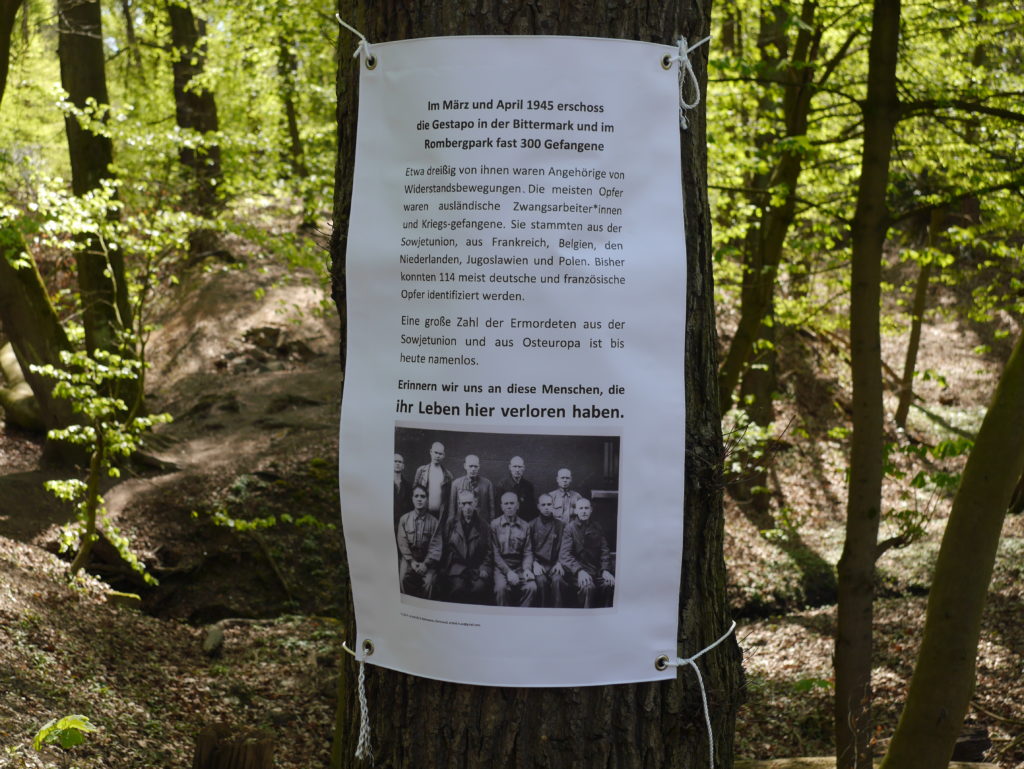Der sowjetische Schriftsteller und Journalist Konstantin Simonow als Berichterstatter am 8. Mai bei der Unterzeichnung der Kapitulation dabei. In seinen Lebenserinnerungen, in denen er über seine Begegnungen mit dem sowjetischen Marschall Goergi Shukow schreibt, berichtet er über dieses denkwürdige Ereignis:
„Sich in die Seele eines anderen Menschen zu versetzen ist nicht leicht, aber man kann sich denken, daß Shukow sich in diesen Stunden nicht nur als Befehlshaber der Front fühlte, die Berlin eingenommen hatte oder als Stellvertreter des Oberkommandierenden, sondern als der Mensch, welcher in diesem Saale jene Armee und jenes Volk vertrat, das mehr als alle anderen getan hatte. Und als Vertreter dieser Armee und dieses Volkes kannte er besser als jeder andere die Ausmaße des Vollbrachten und die durchgestandenen Mühen. In seinem Verhalten gab es weder Hochmut noch Herablassung. Für sein Volk war der soeben beendete Krieg ein Kampf auf Leben und Tod gewesen, und er gab sich mit einer strengen Einfachheit, die unter solchen Umständen dem Sieger ansteht. Auch wenn sich in der Folge unter den besiegten deutschen Generälen und den sich mit uns den Sieg teilenden Verbündeten Leute befanden, die im nachhinein das Ausmaß unseres Beitrages zu diesem Sieg bestritten, so herrschte doch damals, im Mai 1945, in Hinsicht darauf eine bemerkenswerte Einhelligkeit der Meinungen.
Daran ließ nicht einmal das Verhalten des Feldmarschalls Keitel Zweifel aufkommen, der die Kapitulation unterzeichnete. Das muß man ihm lassen: Er führte sich mit der gebührenden Würde auf. Doch gab es daneben in seinem Verhalten auch etwas anderes, Unerwartetes. Man hätte meinen können, daß weder seine politischen Ansichten noch seine Gedanken an die eigene Zukunft ihn drängten, sich Shukow gegenüber mit größerer Aufmerksamkeit zu verhalten als zu den anderen im Saale sitzenden Vertretern des Oberkommandos der Verbündeten. Die Logik des verlorenen Krieges erwies sich jedoch, entgegen Keitels eigenem Willen, als stärker. Als ich ihn während der Prozedur der Kapitulation beobachtete, bemerkte ich mehrmals, daß er Shukow mit unverwandter Aufmerksamkeit beobachtete, gerade ihn und nur ihn. Das war die bittere und tragische Neugier des Besiegten gegenüber jener Kraft, die Shukow hier verkörperte, gegenüber der am meisten gehaßten Kraft, die vorrangig den Ausgang des Krieges entschieden hatte.
Seit ich nun Artikel und Bücher lese, die im nachhinein das Ausmaß unseres Beitrages am Sieg über das faschistische Deutschland in Zweifel ziehen, muß ich immer wieder an Karlshorst zurückdenken, an die Kapitulation und das Gesicht von Feldmarschall Keitel, der mit einer fast unheimlichen Neugier auf Shukow blickte.“
Quelle: Konstantin Simonow, Aus der Sicht meiner Generation, Verlag Volk und Welt, Berlin 1990, Seite 322 bis 324